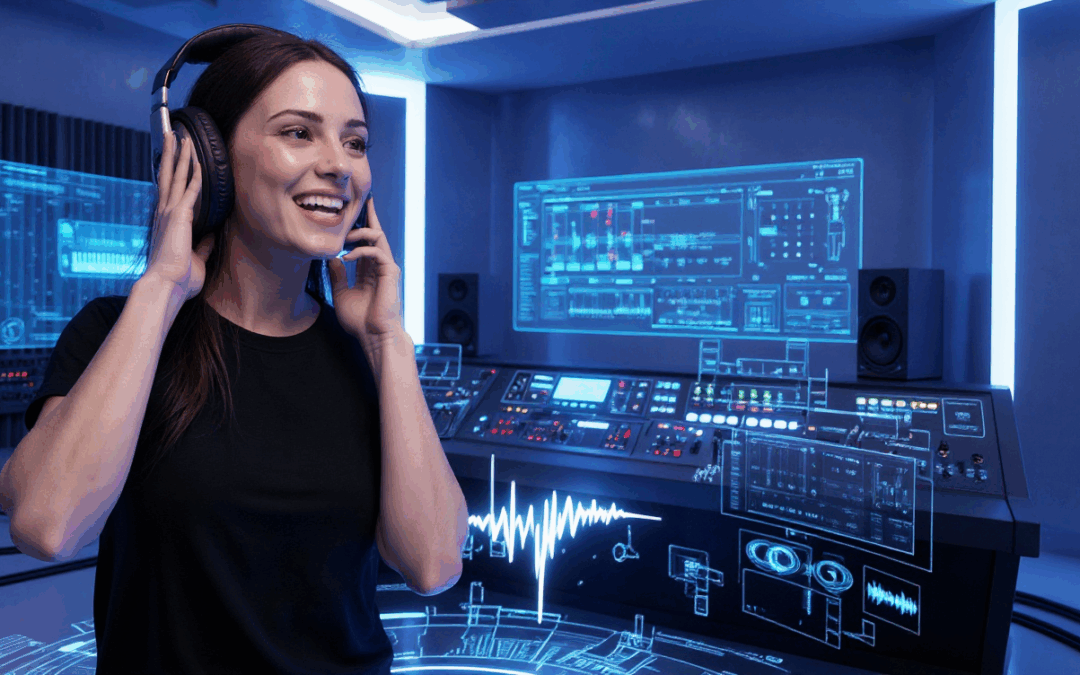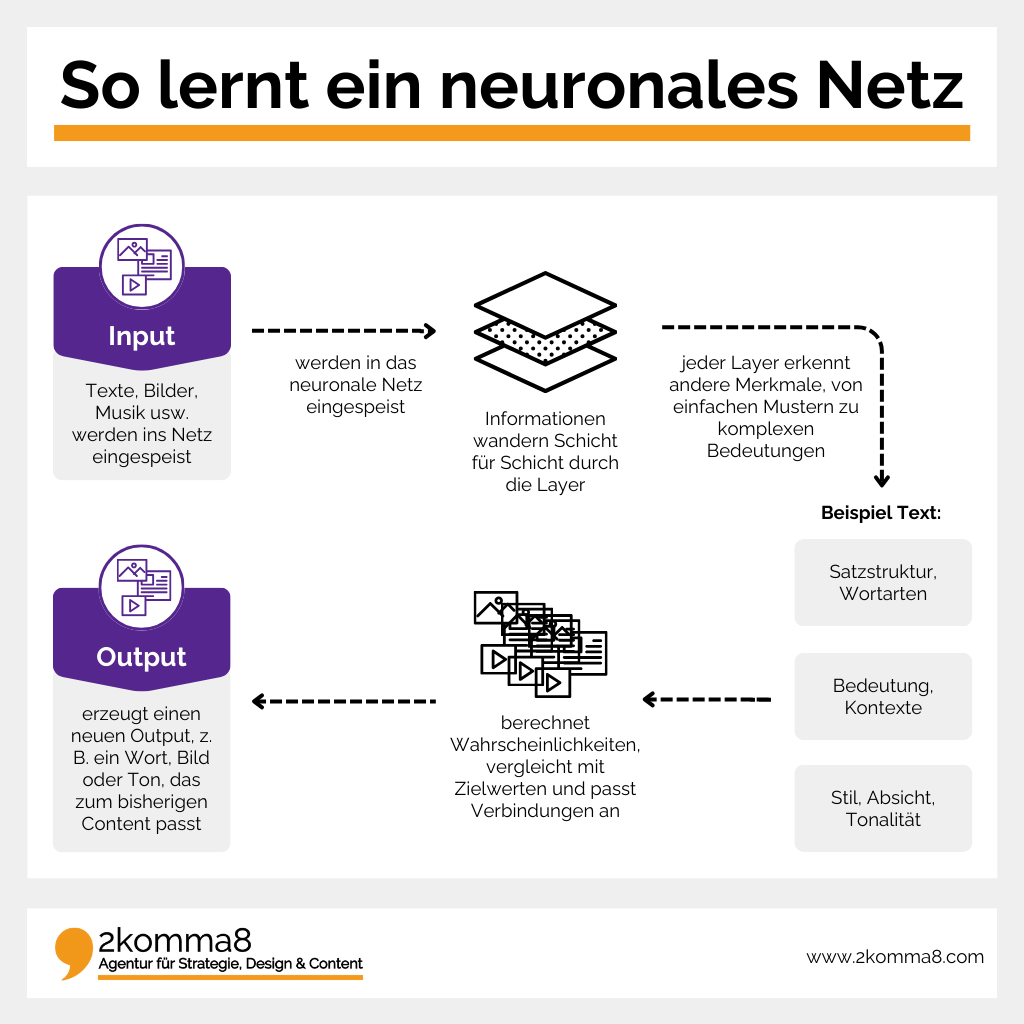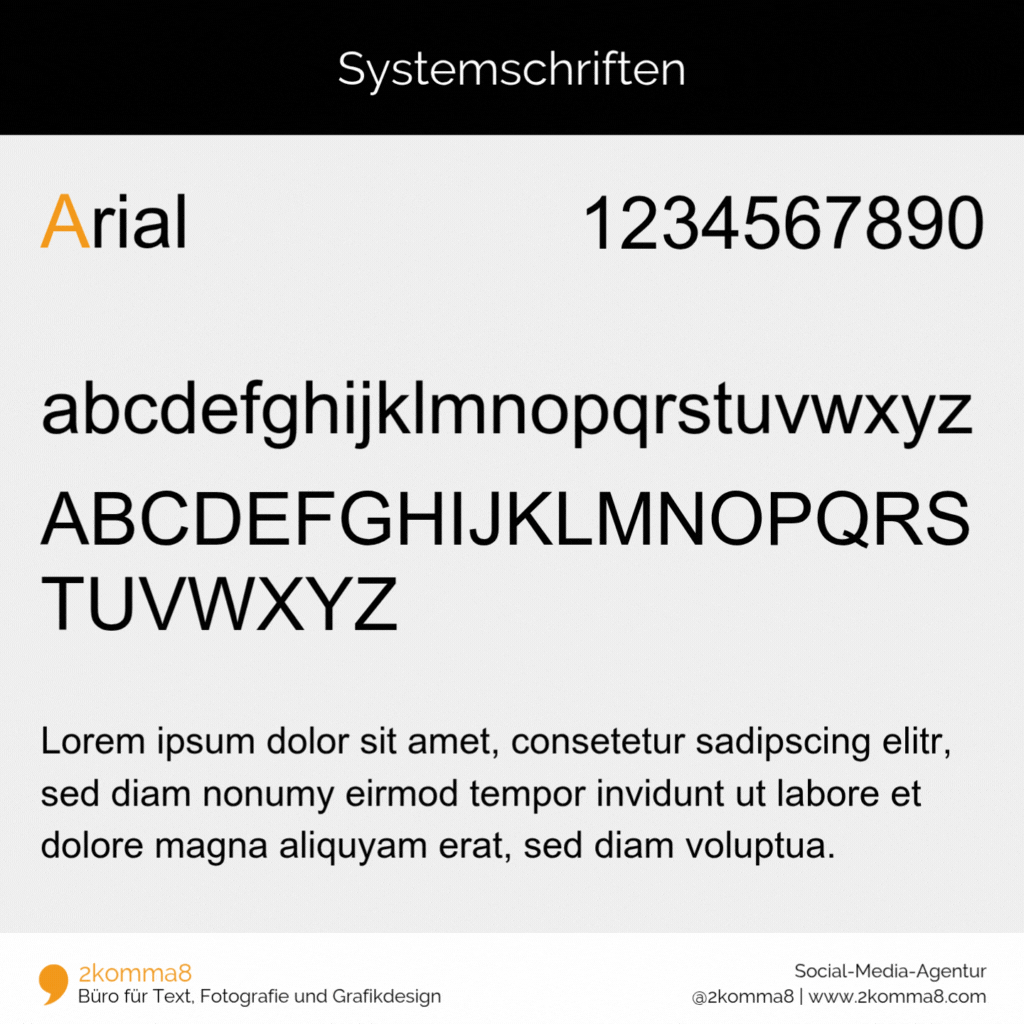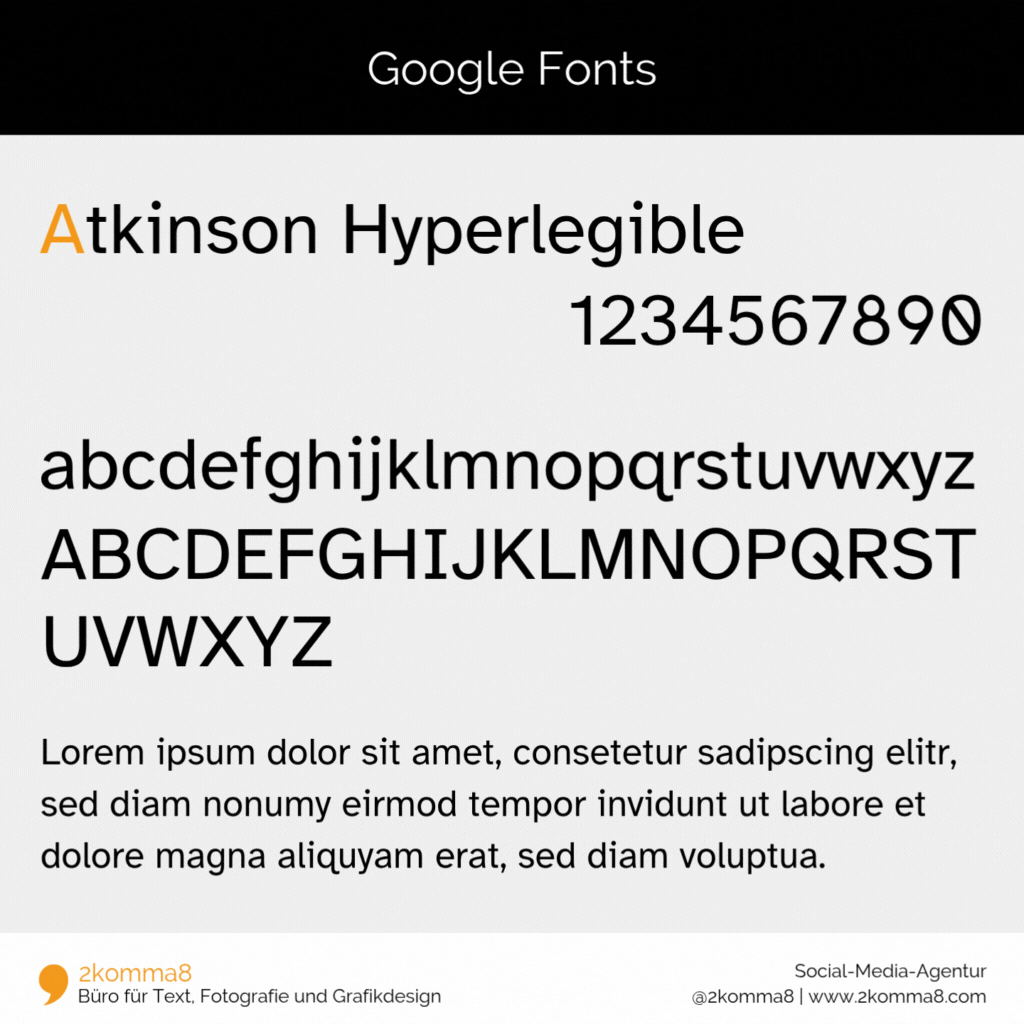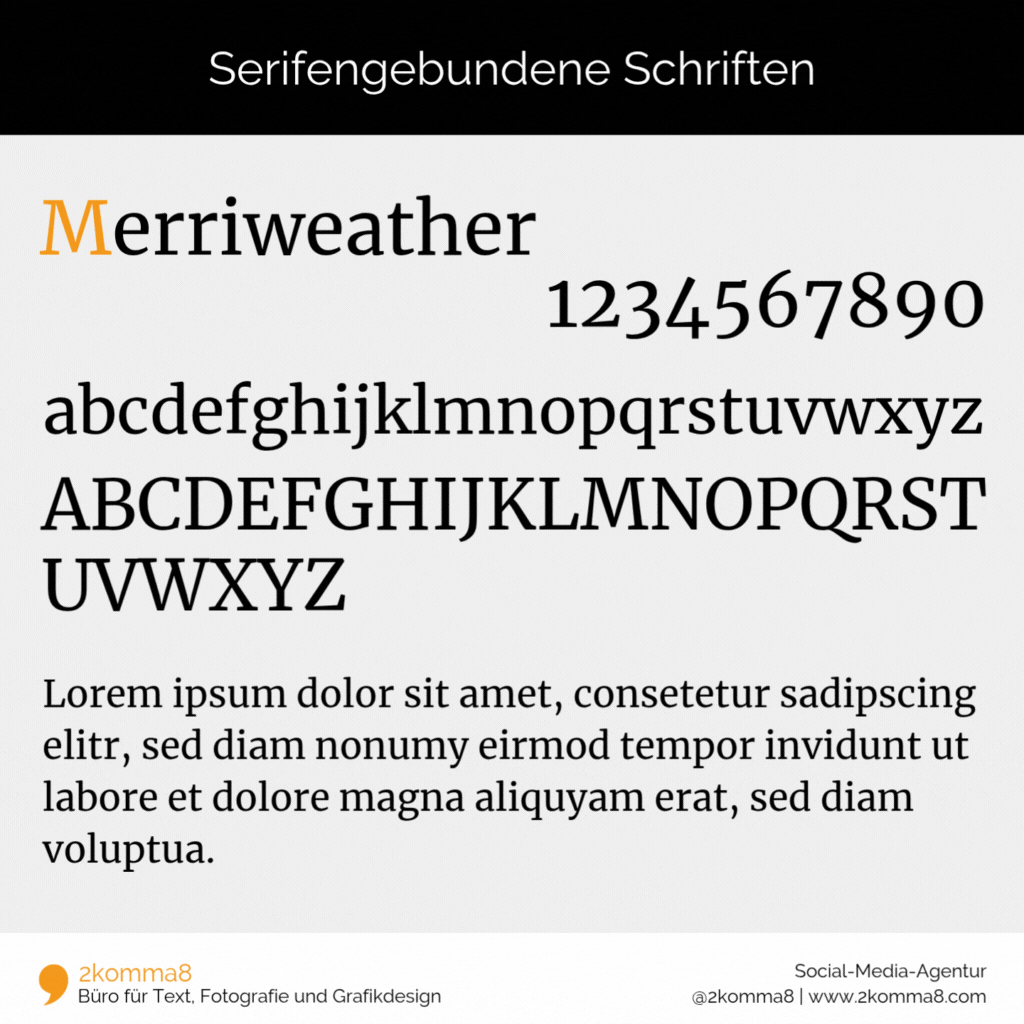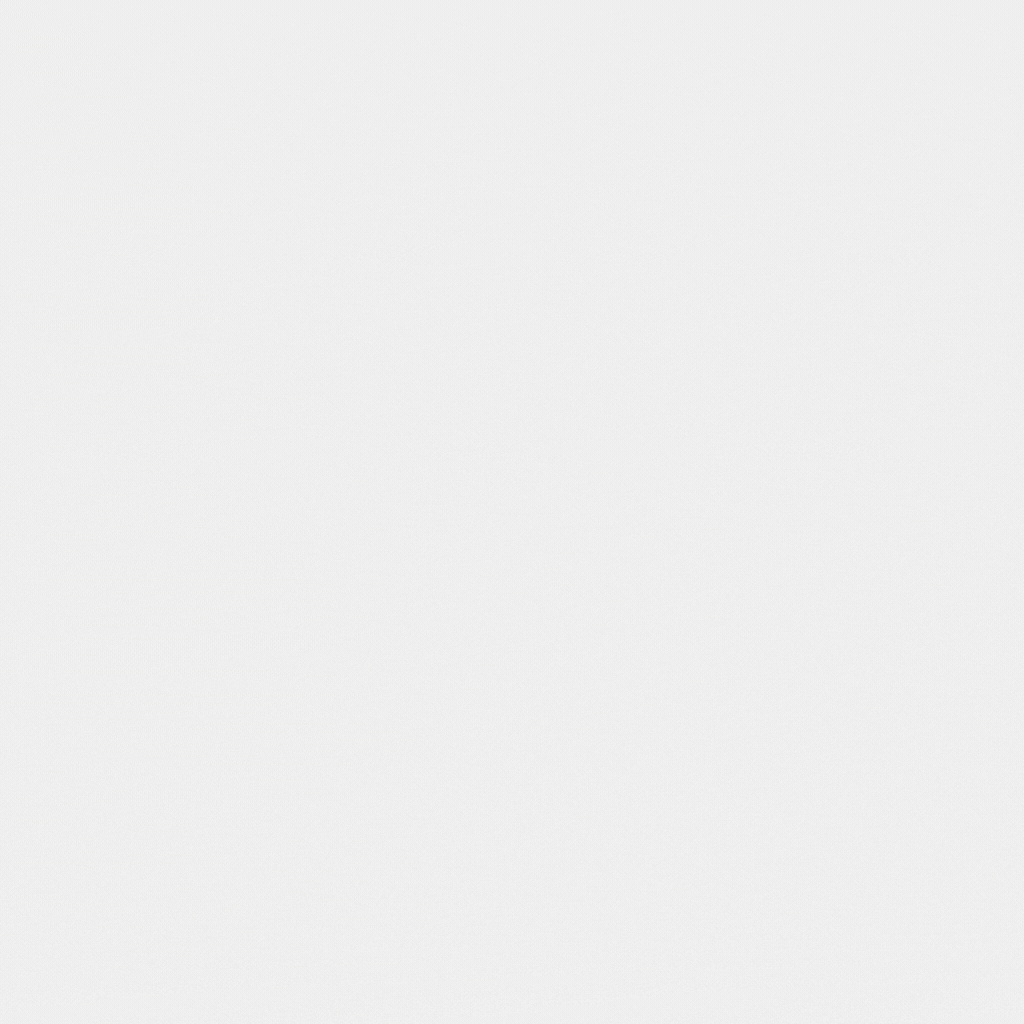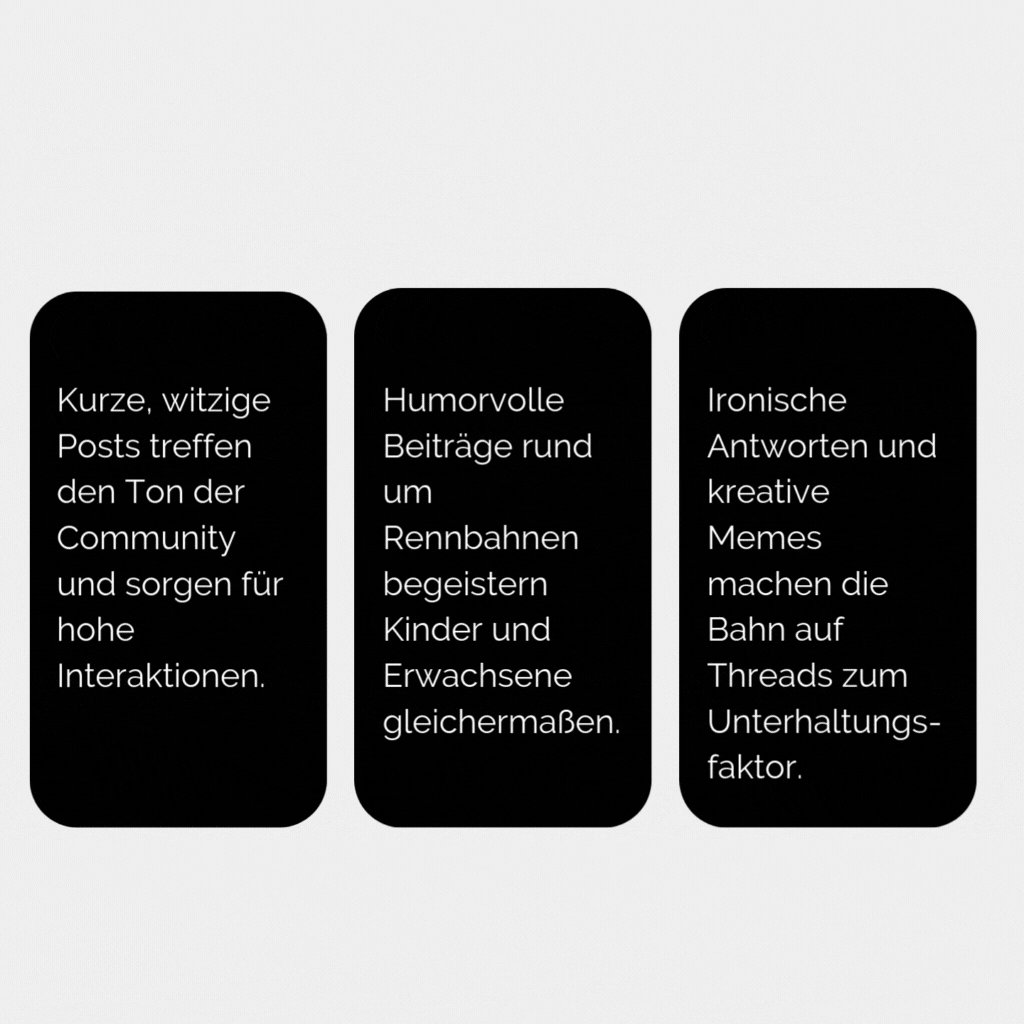2026: LinkedIn hat sich verändert: Diese 8 Dinge müssen Sie jetzt tun, um sichtbar zu bleiben
Bild: SeventyFour (Canva)
Früher haben Ihre Posts gut funktioniert. Heute ist die Reichweite deutlich kleiner? Das frustriert. Aber: Das bedeutet nicht, dass LinkedIn „nicht mehr geht“. Es bedeutet nur, dass sich die Regeln verändert haben. LinkedIn will 2026 vor allem eins: Beiträge, die Menschen wirklich helfen.
Und Beiträge, bei denen Menschen anfangen, zu lesen, zu reagieren, zu kommentieren und schließlich zu speichern oder zu teilen. Wenn Sie diese Logik verstehen, können Sie Ihre Strategie anpassen – und wieder sichtbar werden.
Das Wichtigste in Kürze
Wenn Sie 2026 auf LinkedIn sichtbar bleiben wollen, brauchen Sie vor allem:
- Klare Themen: Entscheiden Sie sich für 2–3 Kernthemen, für die Sie stehen wollen. So versteht LinkedIn Ihr Profil besser – und Menschen erkennen schneller, warum sie Ihnen folgen sollten.
- Echte Kommentare statt nur Likes: Likes sind schnell, Kommentare zeigen echtes Interesse. Stellen Sie deshalb Fragen und laden Sie zur Diskussion ein, denn Gespräche erhöhen Ihre Sichtbarkeit.
- Inhalte, die länger gelesen werden: Wenn Menschen länger bei Ihrem Beitrag bleiben, ist das ein starkes Signal. Schreiben Sie klar strukturiert, mit guten Einstiegen und konkreten Beispielen, damit Leser*innen dranbleiben.
- Native Formate wie Karussell und Video: Karussells und Videos halten Nutzer*innen oft länger auf der Plattform. Nutzen Sie diese Formate, um Inhalte in kleinen Schritten zu erklären und Aufmerksamkeit zu binden.
- Ein aktives Netzwerk: Sichtbarkeit entsteht durch Beziehungen, nicht nur durch Posts. Kommentieren Sie regelmäßig bei anderen und antworten Sie auf Reaktionen – so wächst Vertrauen und Reichweite.
- Relevanz zählt mehr als „neu“: LinkedIn spielt Beiträge stärker nach Interesse und Passung aus, nicht nur nach Zeitpunkt. Darum ist thematische Klarheit wichtiger als „möglichst oft posten“.
Viele Inhalte werden heute stärker nach Relevanz ausgespielt – nicht nur nach „neu“. Außerdem spielt Verweildauer eine wichtige Rolle.
Relevanz und Themenautorität
LinkedIn belohnt 2026 weniger „Hauptsache aktiv“ – und stärker klare Einordnung. Das heißt: Der Algorithmus (und Ihre Leser*innen) wollen schnell verstehen, wer Sie sind, welches Problem Sie lösen und für wen Ihre Inhalte gedacht sind. Wenn das klar ist, werden Ihre Beiträge häufiger den Menschen gezeigt, die genau dafür empfänglich sind.
Warum Fokus wichtig ist
LinkedIn versucht bei jedem Beitrag, 3 Dinge zu „sortieren“:
- Thema: Worum geht es hier genau?
- Zielgruppe: Wer findet das wahrscheinlich hilfreich oder interessant?
- Passung: Passt dieser Beitrag zu dem, was man von Ihnen kennt?
Wenn Sie heute über Recruiting, morgen über Ernährung, dann über Krypto, dann über Mindset schreiben, entsteht kein klares Bild. Der Algorithmus kann schwerer zuordnen, wem er Ihren Content zeigen soll. Und Menschen denken eher: „Aha – wofür steht diese Person eigentlich?“
Merksatz: Fokus macht Sie leichter „einordbar“. Und Einordnung bringt Reichweite.
Typische Fehler, die Ihren Fokus kaputt machen
Viele Profile verlieren Sichtbarkeit, weil sie (unbewusst) in diese Fallen rutschen:
- Zu viele Themen gleichzeitig: Alles ist „irgendwie wichtig“, aber nichts bleibt hängen.
- Zu breite Aussagen: „Marketing ist wichtig“ – ja, aber für wen, in welchem Kontext, mit welchem Ziel?
- Zu viel Trend-Hopping: Heute der neue Hype, morgen der nächste – wirkt unklar.
- Kein roter Faden: Einzelne Posts sind gut, aber zusammen ergeben sie kein Profil.
Kommentare sind wichtiger als Likes
Ein Like ist schnell geklickt. Ein Kommentar bedeutet: „Ich habe mich wirklich damit beschäftigt.“ Genau deshalb zählt LinkedIn Kommentare oft stärker. „Meaningful Engagement“ ist ein wichtiges Signal: echte Reaktionen, echte Gespräche, echter Austausch.
So bekommen Sie mehr Kommentare
Stellen Sie Fragen, die leicht zu beantworten sind, zum Beispiel:
- „Wie sehen Sie das?“
- „Welche Erfahrung haben Sie gemacht?“
- „Was würden Sie anders machen?“
- „Welche Variante passt besser – und warum?“
Und: Antworten Sie auf Kommentare.
Nicht nur mit „Danke“, sondern mit einer kleinen Anschlussfrage. So entsteht ein Gespräch.
Beispiel:
„Spannend, danke! Was war bei Ihnen der Auslöser dafür?“
Authentizität schlägt KI-Floskeln
2026 klingen viele Beiträge auf LinkedIn sehr ähnlich. Oft sind es glatte Texte ohne echte Meinung. Das Problem: Menschen merken das schnell. Und wenn Menschen abspringen, sinkt die Chance auf Sichtbarkeit.
LinkedIn nutzt Signale wie Verweildauer: Wie lange bleiben Menschen bei Ihrem Beitrag?
KI ist okay, aber bitte mit Ihrer Stimme
Sie dürfen KI nutzen. Viele tun das. Wichtig ist: Machen Sie den Text zu Ihrem Text.
Das geht so:
- Nutzen Sie echte Beispiele aus Ihrem Alltag.
- Schreiben Sie klar und einfach.
- Vermeiden Sie Buzzwords („disruptiv“, „skalieren“, „Gamechanger“).
- Zeigen Sie Ihre Prinzipien („Ich finde …“, „Ich empfehle …“, „Ich war überrascht, weil …“).
Mini-Test: Lesen Sie Ihren Post laut vor. Klingt es wie Sie? Dann passt es.
Konzistenz ist wichtiger als jeden Tag posten
Sie müssen nicht täglich posten. Oft ist das sogar zu viel – und wirkt hektisch.
Besser ist: regelmäßig und planbar. Ein guter Rhythmus für viele Profile:
- 2–3 Posts pro Woche
- möglichst an festen Tagen
- mit Zeit für Austausch danach
LinkedIn verteilt Inhalte stärker nach Relevanz und Interessen – nicht nur nach Aktualität.
Wichtig: Wenn Sie posten, planen Sie auch die Zeit danach ein. Denn Kommentare und Antworten gehören zur Leistung dazu.
Native Formate funktionieren oft besser
LinkedIn möchte, dass Nutzer*innen auf LinkedIn bleiben. Darum funktionieren Formate gut, die Menschen länger beschäftigen:
- Karussell-Posts (Dokument/Slides)
- native Videos
- gut strukturierte Textposts (mit klarer Führung)
Karussells und native Inhalte werden häufig empfohlen, weil sie Verweildauer erhöhen und Aufmerksamkeit binden.
Ihre Formel für einen guten Karussell-Post
Erste Folie
klares Versprechen („Sie lernen X“)
Folie 2-6
Schritte, Beispiele, Fehler
Letzte Folie
klare Frage oder Mini-CTA („Was setzen Sie davon um?“)
Ihre Formel für ein gutes Video
20–60 Sekunden
eine Botschaft pro Video
Handy reicht völlig
lieber echt als perfekt
Die ersten Stunden sind wichtig – und Ihr Verhalten auch
Ja, die Startphase zählt. Aber heute gilt auch: LinkedIn kann Beiträge später wieder hochspielen, wenn sie relevant sind.
So nutzen Sie die Startphase:
- Posten Sie nur, wenn Sie danach 30–60 Minuten Zeit haben.
- Antworten Sie zügig auf Kommentare.
- Ermutigen Sie zu Diskussionen (mit Rückfragen).
- Teilen Sie den Post gezielt (nicht wahllos).
Merksatz: Nicht „pushen“. Sondern „Gespräch ermöglichen“.
Netzwerk schlägt „virale Reichweite“
Viele unterschätzen es: Sichtbarkeit entsteht durch Beziehungen. Menschen interagieren eher mit Personen, die sie kennen und schätzen.
Wenn Sie nur posten, aber nie interagieren, wird Ihr Profil „kalt“.
Dann gibt es weniger Kommentare – und damit weniger Sichtbarkeit.
15-Minuten-Netzwerk-Routine pro Tag:
- 5 Minuten: 3 Beiträge kommentieren (mit Substanz)
- 5 Minuten: 1 Person ehrlich gratulieren oder nachfragen
- 5 Minuten: Antworten auf Kommentare unter Ihren Posts
Das ist einfach. Aber sehr wirksam.
Profil und Content müssen zusammenpassen
Viele Menschen posten gute Inhalte – aber verlieren trotzdem Follower*innen und Anfragen. Der Grund ist oft nicht der Post, sondern das Profil. Denn ein Post ist meist nur der „erste Kontakt“. Die Entscheidung fällt auf Ihrem Profil.
Was nach einem guten Post fast immer passiert
Wenn jemand Ihren Beitrag gut findet, läuft im Kopf eine einfache Prüfung:
- Jemand sieht Ihren Post und denkt: „Interessant.“
- Die Person klickt auf Ihr Profil, um mehr über Sie zu erfahren.
- Dann kommt die Frage: Kontaktaufnahme – oder wegklicken.
Das heißt: Ihr Profil muss die Erwartungen erfüllen, die Ihr Content weckt. Wenn Sie über ein Thema posten, aber Ihr Profil wirkt ganz anders, verlieren Sie Vertrauen und damit Conversion (also: Follows, Klicks, Anfragen).
Merksatz: Content bringt Aufmerksamkeit. Das Profil macht daraus Vertrauen.
Mini-Profil-Check
- Headline: Wem helfen Sie und wobei?
- Info/About: kurz, klar, konkret
- Featured: 2–3 beste Inhalte (Karussell, Case, Angebot)
- Kontakt: leicht auffindbar (Website, E-Mail, Terminlink)
Möchten Sie auf LinkedIn wieder sichtbar werden – mit klaren Themen, starken Hooks und Posts, die echte Kommentare auslösen? Dann starten Sie jetzt: Schreiben Sie mir eine Nachricht.
FAQ: LinkedIn hat sich 2026 verändert – so bleiben Sie sichtbar
Was ist 2026 auf LinkedIn der wichtigste Unterschied zu früher?
LinkedIn bewertet stärker, ob Ihr Beitrag für die richtigen Menschen relevant ist – nicht nur, ob er neu ist. Es geht mehr um „Passung“ und weniger um „laut sein“.
Was bedeutet „Relevanz“ auf LinkedIn ganz konkret?
Relevanz heißt: Ihr Beitrag passt zu den Interessen und dem Verhalten Ihrer Zielgruppe. LinkedIn schaut u. a. darauf, wer mit Ihrem Post interagiert und ob die Interaktion „sinnvoll“ ist (z. B. Kommentare, Saves).
Was ist „Themenautorität“ und warum ist sie so wichtig?
Themenautorität bedeutet: Sie werden als verlässliche Stimme für 2–3 Themen wahrgenommen. Wenn Sie regelmäßig dazu posten, kann LinkedIn Ihre Inhalte leichter zuordnen – und Leser*innen verstehen schneller, warum sie Ihnen folgen sollten.
Wie viele Kernthemen sollte ich bespielen?
Am besten 2–3 Kernthemen. Dann bleiben Sie klar erkennbar und wirken nicht „beliebig“. (Wenn Sie 10 Themen mischen, wirkt es für den Algorithmus und für Leser*innen unklar.)
Muss ich 2026 täglich posten, um Reichweite zu bekommen?
Nein. LinkedIn empfiehlt eher konsequent zu posten statt „Dauerfeuer“. Gyanda Sachdeva nennt als Richtwert 2–5 Posts pro Woche; sogar 2 Posts/Woche können im Schnitt deutlich mehr Profilaufrufe bringen.
Warum sind Kommentare wichtiger als Likes?
Ein Like ist schnell, ein Kommentar zeigt echtes Interesse. LinkedIn bewertet „Feedback“ wie Kommentare, Saves, Shares stärker, weil daraus echte Gespräche entstehen.
Was ist die „Verweildauer“ – und warum zählt sie so stark?
Verweildauer (Dwell Time) bedeutet: Wie lange Menschen bei Ihrem Beitrag bleiben (lesen, anschauen, im Kommentarbereich hängen bleiben). LinkedIn beschreibt in Engineering-Beiträgen, dass „time spent“ genutzt wird, um das Feed-Ranking zu verbessern.
Wie erhöhe ich die Verweildauer, ohne Clickbait zu machen?
Schreiben Sie so, dass man leicht dranbleibt: kurze Absätze, klare Zwischenzeilen, konkrete Beispiele. Helfen Sie Leser*innen schnell zu verstehen, was sie im Post bekommen (z. B. „3 Schritte“, „5 Fehler“, „1 Vorlage“).
Welche Formate funktionieren 2026 besonders gut?
Formate, die Menschen länger beschäftigen, sind oft im Vorteil: Dokument-/Karussell-Posts und native Videos. Sie erhöhen häufig die Zeit, die Nutzer*innen beim Inhalt bleiben.
Was heißt „native Formate“ genau?
„Native“ bedeutet: Inhalte direkt auf LinkedIn (z. B. Video-Upload, Dokument-Karussell), statt nur einen externen Link zu posten. So bleibt die Aufmerksamkeit eher auf der Plattform – und das kann sich positiv auf Reichweite auswirken.
Entscheidet sich die Reichweite wirklich in der ersten Stunde?
Die Startphase ist wichtig, weil frühe sinnvolle Signale helfen (Kommentare, Saves, passende Interaktion). Aber: LinkedIn kann Beiträge auch später weiter ausspielen, wenn sie relevant bleiben – deshalb lohnt sich gutes Community-Management auch nach dem Posten.
Was sollte ich direkt nach dem Posten tun?
Planen Sie 20–45 Minuten ein, um Kommentare zu beantworten und das Gespräch zu führen. Antworten Sie nicht nur mit „Danke“, sondern mit einer Rückfrage oder einem Beispiel – so bleibt der Thread lebendig.
Wie wichtig ist mein Profil für Sichtbarkeit?
Sehr wichtig: Viele Menschen klicken nach einem guten Post auf Ihr Profil und entscheiden dort, ob sie Ihnen folgen oder Sie kontaktieren. Wenn Profil und Content nicht zusammenpassen, verlieren Sie Follows und Anfragen – obwohl der Post gut war.
Was gehört in einen schnellen „Mini-Profil-Check“?
- Headline: Wen helfen Sie und wobei – in einem klaren Satz.
- Info/About: kurz, konkret, mit Beispielen statt Floskeln.
- Featured: 2–3 starke Inhalte (z. B. Karussell + Case + Angebot).
- Kontakt: Website/E-Mail/Terminlink sofort auffindbar.
Darf ich KI für LinkedIn-Posts nutzen?
Ja – aber achten Sie darauf, dass es nach Ihnen klingt. Vermeiden Sie generische Phrasen, fügen Sie echte Beispiele und klare Aussagen hinzu, damit Ihr Content „menschlich“ wirkt und länger gelesen wird.

Marielle Viola Morawitz
Expertin für digitale Sichtbarkeit
Dieser Beitrag wurde von Marielle Viola Morawitz, Inhaberin der Berliner Agentur 2komma8 – Büro für Text, Fotografie und Grafikdesign verfasst. Sie unterstützt Unternehmen und Selbstständige dabei, digital sichtbar zu werden – mit klarer Positionierung, starken Hooks und Content, der echte Gespräche auslöst. Ihr Fokus liegt auf Strategien, die Reichweite in Vertrauen verwandeln: Themenautorität, Community-Aufbau und Formate wie Karussell und Video.